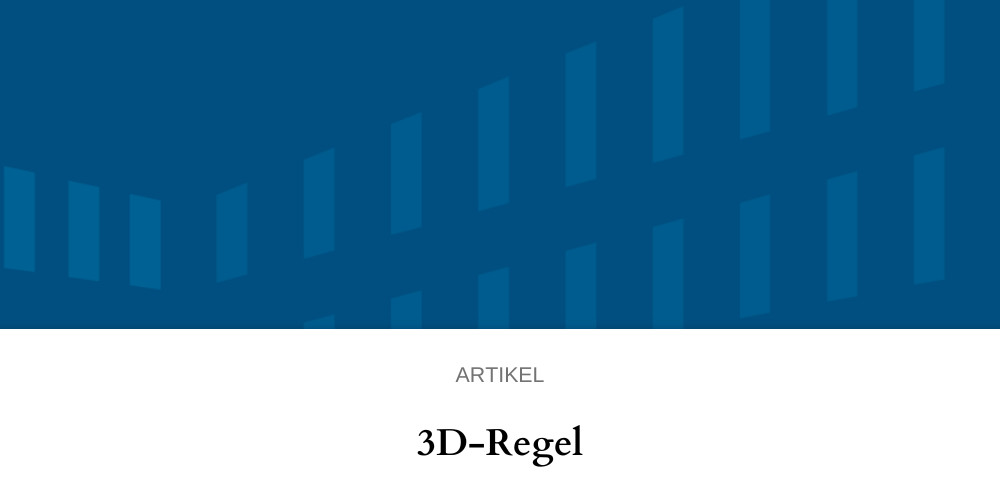Rechtliche Perspektiven
 Rechteinhaber: IJN, Urheber: Viktoria Möslinger-Gehmayr, CC BY-SA 4.0
Rechteinhaber: IJN, Urheber: Viktoria Möslinger-Gehmayr, CC BY-SA 4.0
Dass gegen Antisemitismus rechtlich vorgegangen werden muss, sollte selbstverständlich sein. In Wirklichkeit ist es jedoch häufig anders. Viele antisemitische Vorfälle werden nicht als solche erkannt und deshalb den zuständigen Behörden nicht gemeldet. Damit sich dies in Zukunft ändert, informieren Sie sich hier, wie Sie antisemitische Straftaten erkennen und melden können.
Der Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge im April 2024 und der anschließende Gerichtsprozess werfen Fragen nach juristischer Aufarbeitung und gesellschaftlicher Verantwortung auf.
Das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus Oldenburg beleuchtet in seinem Bericht den Gerichtsverlauf, die juristische Einordnung sowie die zivilgesellschaftlichen Reaktionen auf den antisemitischen Angriff.
Zum BerichtIn Niedersachsen ist unter Beteiligung der staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen ein Leitfaden erarbeitet und verschriftlicht worden, der das Erkennen und Beurteilen von antisemitischen Zusammenhängen vereinfacht und zu mehr Handlungssicherheit der Justizbehörden führen soll.
Zum LeitfadenHier kommen Sie zur Eingabemaske der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS), um antisemitische Vorfälle zu melden.
Vorfall meldenMit der sogenannten 3D-Regel lässt sich bestimmen, ob es sich bei einer Äußerung lediglich um Kritik an Israels Politik handelt oder die Grenze zum Antisemitismus überschritten wird: Das ist der Fall, wenn Doppelstandards, Delegitimierung oder Dämonisierung Israels im Spiel sind. Der Schnelltest wurde 2004 vom israelischen Politiker und Wissenschaftler Nathan Sharansky entwickelt, um Texte und Äußerungen systematisch daraufhin zu prüfen, ob sie antisemitisch sind.
Zu Erläuterungen zur 3D-RegelAntisemitismus und das deutsche Rechtssystem - eine Perspektive
Antisemitismus steht im völligen Gegensatz zu den menschlichen Grundwerten des deutschen Grundgesetzes (Verfassung). Die Verfassung stellt gleich im ersten Artikel die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen in den Vordergrund. Zudem bekennt sie sich zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und des Friedens.
In der Bundesrepublik Deutschland gelten juristische Maßnahmen daher als eines der elementarsten Werkzeuge im Kampf gegen Antisemitismus. So ermöglicht das deutsche Rechtssystem auch ein ganzheitliches Vorgehen gegen antisemitische Aussagen und Handlungen auf Basis der Vorschriften aus dem Straf-, Zivil- und Öffentlichen Recht.
Die Bundesregierung handelt so, da sie davon ausgeht, dass ein konsequentes rechtliches Handeln gegen Antisemitismus das Vertrauen der Bürger*innen in die Effektivität des deutschen Rechtsstaates bestärkt. Auch will sie innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ein Gefühl von Sicherheit schaffen. So bemüht sich die Bundesregierung, die bestehenden Gesetze und Rechtsverordnungen einer kritischen Durchsicht zu unterziehen und Gesetzeslücken zu schließen.
Positiv festzustellen ist, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass die Anwendung von Vorschriften auf antisemitische Vorkommnisse mangelhaft erfolgt.
Problematisch ist, dass Antisemitismus als Rechtsbegriff bislang nicht definiert und präzise formuliert ist.
Eine abstrakte Einordnung mutet angesichts der Komplexität von Rechts- und Antisemitismusdefinition schwierig an. Es ist eine dringende Notwendigkeit innerhalb der deutschen Gerichte und Staatsanwaltschaften eine rechtsverbindliche Auslegungshilfe zu etablieren.
Sind Sie jung oder alt? Jüdisch oder nichtjüdisch? Kulturell oder wissenschaftlich interessiert? Tourist*in, Niedersächs*in oder Weltbürger*in? Sie haben Ideen, Anregungen oder Wünsche? Werden Sie Teil des Onlineportals und beteiligen Sie sich gern an unserem Projekt. Sprechen Sie uns an!
 Rechteinhaber: F. de Vries, IJN, CC BY-SA 4.0
Rechteinhaber: F. de Vries, IJN, CC BY-SA 4.0